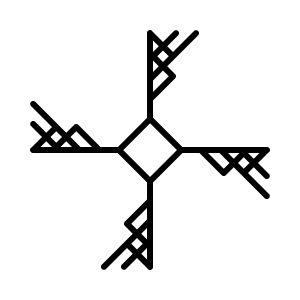Still sind sie da, die Matronen
(Obiges Foto vom Matronen Weihestein Nettersheim, Matronae Aufaniae, Quellfoto: Sockenbaer; 2005, GNU Freie Dokumentationslizenz)
Still sind sie da, die Matronen
Die von Rom ausgehende sog. äussere Christianisierung und teils damit verbundene Völkerwanderung der in Europa lebenden heidnischen Völker, begann effektiv im 4. Jahrhundert und dauerte bis ins 13. Jahrhundert an. Während dieser gravierenden Zeit entstanden innerhalb des eroberten Europas römische Provinzen mit Abgesandten von Rom, welche dafür sorgten, dass die meistens zwangsmässig christianisierte einheimische Bevölkerung sich ans Christentum hielt und ihre heidnischen Brauchtümer nicht mehr pflegte. So war beispielsweise die ehemalige römische Provinz Niedergermanien westlich des Rheins und im südlichen Rheinland angesiedelt. Kulturhistorische Forschungen haben ergeben, dass präzis in diesen Gebieten ca. achthundert Matronensteine existieren, welche datiert sind auf die Zeit von 70 bis 240 n. Chr. Jene wurden teilweise bei Ausgrabungen von Tempelanlagen oder ganz einfach bei Strassenbauarbeiten entdeckt, andere frei stehend in schöner Landschaft, auffallend oft an Seen, Quellen oder kleineren Flüssen.
Wer sind die Matronen?
(lat. Matrona: Familienmutter, vornehme Dame, ältere Frau, die Gesetztheit und Würde ausstrahlt)
Matronen müssen Göttinnen sein, aber es fehlen antike schriftliche Zeugnisse dafür. Es existieren nur lateinische Inschriften und bildliche Darstellungen auf Votivsteinen und Altären. Ausserdem ist äusserst typisch für sie, dass sie nur in der römisch-germanisch-keltischen Religion vorkommen. Entdeckt wurden sie vor allem in den Nordwest- und Nordost-Provinzen des Römischen Reiches sowie im keltisch besiedelten Gallien, Nordspanien, Norditalien und Süditalien. Es wird angenommen, da in Europa viele Volksgruppen unterwegs waren, dass die Matronenheiligtümer durch römische Legionäre, insbesondere germanische Militärangehörige und durch umgezogenen Siedler verbreitet wurden.
Die Matronenforschung kommt bis dato zum Schluss, dass es sich mit Sicherheit um Muttergottheiten handelt. Diese wurden immer als sitzende Dreiergruppe von Frauen dargestellt, wovon die mittlere der Drei offenes schulterlanges Haar trägt und die beiden Frauen rechts und links ihr Haar mit trachtenähnlichen Hauben zugedeckt halten. Die drei Matronen halten auf ihrem Schoss jeweils Fruchtkörbe, Pflanzen, Blumen, Füllhorn, Wickelkinder oder manchmal Schmuckkästchen mit Weihrauch. Allen gemeinsam ist, dass diese Göttinnensteine einem Matronenkult entspringen und meistens zum Dank oder zur Bitte gestiftet wurden, um Schutz, Fruchtbarkeit, Genesung usw. zu erhoffen. Leider ist wenig bekannt über die konkrete Form des Matronenkults. Die Vermutung liegt sehr nahe, dass die Matronen eng mit den drei germanischen Schicksalsfrauen, den Nornen, in Zusammenhang stehen.